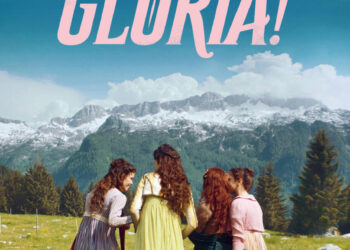Eine Familie im Ausnahmezustand. Tom (Lars Eidinger) ist Dirigent. Seine Eltern stehen kurz vorm Tod, seine Schwester ist Alkoholikerin und hat keinen Kontakt mehr zur Familie und der beste Freund ist schwer depressiv…
Erst unlängst gab es die überaus gelungene, eigenwillige Filmkomödie von Charly Hübner SOPHIA, DER TOD UND ICH. In den Buchläden reüssiert zurzeit ein Roman von Bernhard Schlink DAS SPÄTE LEBEN als „kluge Auseinandersetzung mit dem Tod“ (FAZ). Diese und eine Reihe weiterer aktueller Werke sind unausgesetzt fasziniert vom schmerzlichen Geheimnis des Sterbens.

Lars Eidinger:
„Ja, schmerzliches Geheimnis, sagen Sie…
In „Hamlet“ heißt es ja, das unbekannte Land, über dessen Grenze kein Reisender zurückkehrt. Es ist ja eigentlich kurios, dass Sterben tatsächlich so etwas Rätselhaftes hat. Oder der Tod, so etwas Rätselhaftes, fast Mystisches – und auch von unserer Gesellschaft weitestgehend tabuisiert wird. Das führt dann dazu, dass man zum Beispiel so einen Film dreht; der hat dann den sogenannten Arbeitstitel „Sterben“. Und irgendwann heißt es: Ja, aber die Redaktion oder die Produktion wünscht sich schon einen lebensbejahenderen Titel. Wer geht schon in einen Film, der „Sterben“ heißt? Die Berlinale-Einladung hat uns dann so ein bisschen in dem Titel bestätigt – deswegen ist es auch bei „Sterben“ geblieben. Und trotzdem frage ich mich dann: Ja, aber was erzählt es eigentlich über eine Gesellschaft, wenn Sterben kein Thema ist?
Das ist ja so ein Irrglaube oder ein Missverständnis, dass man sagt, der Tod wartet am Ende des Lebens auf einen. Der begleitet einen ja eigentlich ständig. Jeder vergangene Moment ist ein toter Moment – es ist allgegenwärtig. Und es ist fast eine beruhigende Erkenntnis, dass das Leben unmittelbar vom Tod abhängt. Also, das Leben würde es ohne den Tod nicht geben – und umgekehrt. Da liegt eine Schönheit in dem Gedanken, dass der Tod dem Leben erst seinen Wert gibt.
Mich hat immer fasziniert – zum Beispiel bei Vampir-Filmen – dass ich dachte, warum sind die denn jetzt alle so unglücklich, wenn die Untote sind, und wenn die nie sterben müssen? Aber das führt dann anscheinend dazu, dass die sich nichts sehnlicher wünschen, als wieder sterblich zu sein.“
Wer ist also dieser Tom? Er hat einiges durchzumachen. Der an Demenz leidende Vater stirbt im Seniorenheim, aber auch die Mutter ist schwer krank. Und die Beziehung zu ihr ist seit Toms Kindheit gestört. Neben den anspruchsvollen Proben für die Uraufführung seines aktuellen Konzerts muss er seiner Exfreundin bei der Geburt ihres Kindes assistieren, für das er zum Ersatzvater bestimmt wird. Irgendwann gerät er in den Bereich aktiver Sterbehilfe für seinen depressiven Freund, dessen Komposition „Sterben“ Tom gerade mit dem Orchester probt.
Lars Eidinger:
„Also, es ist eine ganze Menge… Dann, bei diesen extremen Ereignissen, schaffen sie immer, dass der Film trotzdem Bodenhaftung hat und nie, nie so pathetisch wird. Das hat mir sehr gefallen. Ja, ich glaube, das ist diese Gratwanderung, von der auch die Figur des Komponisten Bernard, den Robert Gwisdek spielt, redet. Also dieser schmale Grat – es gibt da ein ganzes Kapitel in dem Film, das so heißt, und da geht es eigentlich genau darum, diesen schmalen Grat zu treffen. Auch wenn die Figuren in dem Film sagen, das ist eigentlich unmöglich…

Ich finde den Film tatsächlich im besten Sinne unromantisch. Es gibt ja so einen Ausspruch von Bertolt Brecht, der gesagt hat: „Glotzt nicht so romantisch!“ Das meint ja, dass man sozusagen auf die Illusion reinfällt.
Und Brecht hatte sein Publikum wahnsinnig ernst genommen und meinte, das Publikum muss natürlich immer analytisch draufgucken, und dann wird die Wahrnehmung komplexer.
Ich finde, der Film hat einen sehr analytischen Blick eigentlich aufs Sterben und aufs Leben. Und ja, so habe ich auch versucht, diesen schmalen Grat zu treffen von der Figur, die natürlich auch einen Hang zum Pathos hat. Oder auch einen Hang zur Romantik oder auch zur Nostalgie – wie wir alle.“
Regisseur und Autor Matthias Glasner erspart Tom nichts. Er geht immer wieder in die Vollen und schafft es, dass seine Darsteller auch in den heikelsten Situationen authentisch agieren.
Da ist natürlich ein ganzes Ensemble vorzüglicher Darsteller am Platz: Corinna Harfouch spielt Toms Mutter und Hans-Uwe Bauer den Vater, Robert Gwisdek seinen lebensmüden Freund – alle drei nominiert für den Deutschen Filmpreis. Lilith Spangenberg spielt die alkoholabhängige Schwester mit Borderline-Symptomen und Ronald Zehrfeld ihren Zahnarzt-Chef und Liebhaber mit ungeklärtem Familienstand. Die Beiden erlebt in hochgradig kuriosen Szenen – u.a. eine Situation in der Arztpraxis, die einem die Lust auf Zahnbehandlungen nachhaltig verleiden könnte.
Sie haben eine wundervolle, lange, anrührende und bittere Dialog-Szene mit Corinna Harfouch. Konnten, oder mussten sie da improvisieren?
Lars Eidinger:
„Nein, in dem Film wird gar nicht improvisiert. Also, ich finde es generell die größte Herausforderung, Texte so zu sprechen oder ein Drehbuch so zu spielen, als wenn es improvisiert wäre. Aber dafür ist mein Respekt viel zu stark für Autoren und Autorinnen. Ich glaube, da überschätzen sich viele Schauspieler und Schauspielerinnen, indem sie sagen: „Ja, ich spreche das dann irgendwie so, wie ich denke.“
Das ist alles genau so aufgeschrieben, wie wir das gespielt haben, da war für Improvisation nicht viel Platz. Also, was natürlich improvisiert ist, weil man es gar nicht in dieser Länge wirklich durch-strukturieren kann, ist die Rhythmik der Szene. Wenn man etwas spielt, das 24 Minuten lang dauert, dann kann man es vorher nicht so durchkomponieren, dass man sagt, da machst du eine Pause. Sondern, das ist etwas, was man tatsächlich miteinander im Moment unmittelbar entscheidet. Und das war auch so die große Lust an der Szene.“
Sie spielen einen Dirigenten. Mussten sie das trainieren, oder hat man so etwas als Schauspieler einfach drauf?

Lars Eidinger:
„Nein, das muss man schon trainieren. Also ich hatte auch den Ehrgeiz, das zu trainieren. Ich gebe ehrlich zu, manchmal denkt man im Nachhinein, vielleicht hätte ich gar nicht so viel dafür trainieren müssen. Also ich habe mal für einen Film Klavierspielen gelernt bzw. die ersten Töne. Und dann ist es ja immer so: Wenn jemand abgefilmt wird, der eigentlich nicht spielen kann – so wie ich – dann sieht man immer, wie ich die ersten Tasten drücke, dann fährt die Kamera aufs Gesicht, und dann weiß man, jetzt stimmt da unten gar nichts mehr…
Und beim Dirigieren? Da war es so: Ich habe von Null angefangen, also von der Pike auf sozusagen dirigieren gelernt. Es ist ganz einfach, ein 4/4 Takt… (er dirigiert) So! Und dann ein 3/4 Takt… So! Das wurde mir beigebracht, und das war schon sehr mühselig.
Ich merke auch, wie man immer die Angst hat, dass da unten so viele selbsternannte Fachleute sitzen, die alle genau wissen, wie es eigentlich geht. Diesem Druck oder dieser Erwartungshaltung habe ich mich schon ein bisschen ausgesetzt gefühlt.“
Mag sein, dass der Film manchem zu heftig wird, dass er möglicherweise mit 180 Minuten gelegentlich zu lang scheint. Aber wirklich nur: scheint! Denn die Filmemacher haben sich da ganz bewusst auf etwas „eingelassen“.
STERBEN ist ein überaus mutiger Film. Darüber hinaus ist er grotesk, zärtlich und überraschend komisch.
Der Regisseur sagt es in seiner „Director‘s Note“ so:
„Wir drehen in einem somnambulen Zustand. Wir treffen uns morgens und fangen einfach an, ohne Proben, jeden möglichen Zweifel verdrängend, no hope no fear, wie Caravaggio sagt, einfach immer weiter. Auf der Suche nach der Magie des Augenblicks, den die Kunst für einen bereit hält, wenn man sich dafür öffnet, in dem man ihn nicht erzwingen will.
Und da wir auch keine Mittagspausen machen, gehen wir jeden Abend gemeinsam Essen und reden viel, über uns, über die anderen und über das Unglück der Zeit. Und all das strömt in das Unterbewusstsein dieses Films ein, der wie ein lebendiger Organismus ist, weil wir ihn uns nicht „erarbeiten“, sondern einfach LEBEN.“
Insofern ist STERBEN nicht nur ein Film über den Tod, sondern eine Geschichte zum Überleben.